Wenn heute über Tierhaltung, speziell Schweinehaltung, diskutiert wird, geht es meistens um mehr Tierwohl und höhere Haltungsstufen. Das ist schon eine große Baustelle für die Betriebe. Aber im Raum steht ebenso die Forderung nach mehr Nachhaltigkeit. Im Fokus dabei konkret: der CO2-Fußabdruck. (Fern-)Ziel des Lebensmittelhandels ist, dass er künftig auf jeder Fleischpackung abzulesen ist.

„Wir Tierhalter brauchen uns hier überhaupt nicht zu verstecken, gerade auch, was Nachhaltigkeit angeht“, sagt Andre Stratmann selbstbewusst. Der 43-jährige Landwirt aus Bühren im Landkreis Cloppenburg mästet auf 1.600 Plätzen Schweine. Weitere Betriebszweige sind die Putenmast, Ackerbau sowie die Beteiligung an einer Sauenzuchtanlage.
Andre Stratmann ist Mitglied der Erzeugergemeinschaft Oldenburger Münsterland eG und somit der Goldschmaus Gruppe verbunden. Er hat für seine Schweinemast den CO2-Fußabdruck berechnet – bzw. berechnen lassen: „Das kann ich als einzelner Betrieb kaum alleine machen.“ Er nahm das diesbezügliche Angebot seines Vermarkters Böseler Goldschmaus und seines Futtermittelherstellers GS – die Genossenschaft an.
Noch kein einheitliches System zur Berechnung
„Unsere Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel fragen schon heute nach dem CO2-Fußabdruck beim Schweinefleisch“, sagt Dr. Gerald Otto vom Schlachthof Böseler Goldschmaus. Also wurde zusammen mit GS- die Genossenschaft ein Tool genutzt, mit dem dieser Fußabdruck berechnet werden kann. „Das ist sehr aufwändig und letztlich noch nicht übergreifend vergleichbar, weil es kein allgemeingültiges Rechenmodell für alle Produktionschritte und -varianten gibt“, so Dr. Otto. Zurückgreifen kann man nur auf einige anerkannte Datenbanken, zum Beispiel zu bestimmten Futtermittelherkünften.
Für Landwirt Andre Stratmann geht es nicht nur darum, seinem Vermarkter die gewünschten CO2-Daten zu liefern. Er selbst weiß um die Effektivität der Schweineproduktion in der Region: „Wir haben hier sehr gute biologische Leistungen, etwa was Zunahmen und Futterverwertungen angeht. Das sind wichtige Nachhaltigkeitskriterien.“ Für ihn und seine Berufskolleginnen und Berufskollegen gehe es darum, das nach außen zu kommunizieren: „Die Fleischproduktion steht in der Kritik, mit Nachhaltigkeit können wir punkten.“
Auch der Betrieb profitiert von Verbesserungen
Und natürlich bedeute mehr Nachhaltigkeit für den Betrieb Einsparen von Ressourcen, sprich, Einsparen von Betriebsmitteln und damit von Produktionskosten: „Wenn ich meine Futterverwertung um 0,1 Punkte verbessern kann, senke ich nicht nur den CO2-Fußabdruck meiner Schweine, sondern spare Futterkosten“, zeigt Andre Stratmann die Win-Win-Situation auf.
Seine Beratung unterstützt ihn dabei, Optimierungen der Produktion zu erreichen. Vom Vermarkter Böseler Goldschmaus gibt es zudem einen Extra-Anreiz: Liegt man bei der Futterverwertung besser als der Schnitt der Erzeugergemeinschaft, bekommt man einen Bonus von 1 Euro/Schwein.
„Auch Nachhaltigkeit kann nur in der Kette gedacht werden“
Die Böseler Goldschmaus Gruppe steht für eine regionale Produktion von Schweinefleisch, aber auch von Rindfleisch. Zur Gruppe gehört der Schweineschlachthof in Garrel, Landkreis Cloppenburg. 2023 wurden hier 1,7 Mio. Schweine geschlachtet. Damit liegt Böseler Goldschmaus auf Platz 6 im deutschen Schlachthofranking (Quelle: ISN). Insgesamt wurden 2023 hier-zulande knapp 44 Mio. Schweine geschlachtet.
Eigenes Label
Der Schlachthof in Garrel gehört zu einem Teil den liefernden Schweinehaltern, die in einer Erzeugergemeinschaft organisiert sind. Beteiligt sind zudem die Futtermittelunternehmen GS – die Genossenschaft, Schneiderkrug, und Fleming &Wendeln, Garrel. Die Erzeugergemeinschaft zählt derzeit rund 1.000 Mitglieder. Vermarket werden Schweine- und Rindfleisch seit gut zehn Jahren in Deutschland unter dem eigenen Label „Goldschmaus – Die Marke der Bauern“.
Regionalität
Neben dem Fokus Regionalität verfolgt die Goldschmaus Gruppe schon länger das Ziel, mehr Tierwohl umzusetzen. So liegt der Anteil an Schweinen, die in den Mitgliedsbetrieben nach den Kriterien der Initiative Tierwohl (entspricht Haltungsstufe 2 des Handels) gehalten werden, bei 95 Prozent.
Inwieweit es hier künftig einen Wechsel zu Haltungsstufe 3 oder 4 geben wird, vermag Dr. Gerald Otto, bei Böseler Goldschmaus u. a. für Tierschutz zuständig, aktuell kaum zu prognostizieren: „Die Forderung des Lebensmittelhandels ist da, das Problem ist aber, dass es bei Ställen kaum eine Neu- oder Umbaugenehmigung für Außenklima oder Auslauf (Stufe 3 bzw. 4) gibt.“
Klimaschutz
Die Goldschmaus Gruppe beschäftigt sehr stark das Thema Nachhaltigkeit: „Wir haben bereits auf freiwilliger Basis einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Zukünftig unterliegen wir jedoch der Berichtspflicht. Unsere Abnehmer fordern zudem eine Teilnahme an der SBT-Initiative („Science-Based-Targets“=Wissenschafts-basierte-Ziele). Diese Initiative unterstützt die Ziele des Pariser Klimaabkommens. Unternehmen wie wir sollen Klimaschutzmaßnahmen vorantreiben, sprich, zum Beispiel den CO2-Fußabdruck ihrer Produktion senken“, erklärt Dr. Gerald Otto.
Ziel bei Böseler Goldschmaus ist, die bei der Schweinefleischproduktion anfallenden CO2-Emissionen transparent zu erfassen – und natürlich zu reduzieren. Die Erfassung der CO2-Emissionen in den Mitgliedsbetrieben ist derzeit in der Umsetzung: „Durch unsere integrative Struktur ist die Stufe ‚Futtermittel‘ mit eingebunden. Das ist wichtig, weil hier der größte Hebel zur Reduzie-rung liegt. Wir gehen davon aus, dass die Futtermittelhersteller ihr Futter demnächst mit einer Deklaration des CO2-Fußab-drucks liefern.“
Integration
Für den Agraringenieur steht außer Frage, dass das komplexe Thema „Reduzierung CO2-Fußabdruck“ nur in der gesamten Wertschöpfungskette gemeinsam umgesetzt werden kann: „Wir haben bei uns eine enge Einbindung der Betriebe, das ist unser großes Plus“, sieht er diesen Teil der Nachhaltigkeits-Anforderungen entspannt.
In der Schweinefleischbranche arbeitet man derzeit daran, den CO2-Fußabdruck als weiteres Kriterium in das QS-Prüfsystem einzugliedern. QS (Qualität und Sicherheit) ist das etablierte Prüfsystem für Lebensmittel, auch für Fleisch. „Künftig kennt man dann zu jedem geschlachteten Schwein nicht nur den Herkunftsbetrieb oder die Haltungsform, sondern auch den CO2-Fuß-abdruck“, so Dr. Otto.
Fütterung ganz nah am Bedarf der Tiere
Bei Stratmanns Mastschweinen wird, wie schon bei einem Teil der Schweinemastbetriebe in der intensiven Veredlungsregion Nordwest-Niedersachsen, in sechs Phasen gefüttert. Die Tiere bekommen nacheinander sechs unterschiedliche Futter – immer sehr nah an ihrem tatsächlichen Bedarf. Das gilt speziell auch für die Versorgung mit Stickstoff und Phosphor: „Stickstoff und Phosphor sind teure Futterkomponenten, zum anderen verlangt auch die Düngeverordnung einen restriktiven Umgang.“
Wie gut er bezüglich der Restmengen Stickstoff und Phosphor in seiner Gülle schon liegt, zeigen ihm die Auswertungen seines Beratungsringes Cloppenburg-Löningen: „Im Vergleich zu Standardwerten liege ich bei Stickstoff gut 20 Prozent niedriger, beim Phosphor sogar zwei Drittel niedriger.“

Futter steht für 60 bis 70 Prozent des CO2-Abdruckes
Das ist nicht nur bezüglich der Düngeverordnung von Vorteil, sondern eben auch für die CO2-Bilanz seiner Tiere. „Das Futter macht etwa 60 bis 70 Prozent des CO2-Fußabdruckes aus in der Schweinemast“, ergänzt Dr. Gerald Otto. Hier liegt also in vielen Betrieben ein wichtiger Hebel für die Reduzierung. „Wenn man aber schon gut ist, ist das Potenzial für Verbes-serungen natürlich geringer“, schränkt er ein.
Andre Stratmann liegt mit seinem berechneten CO2-Fußabdruck denn auch schon unter dem Durchschnitt im Olden-burger Münsterland: Bei ihm sind es 3,8 kg CO2e/kg Schlachtgewicht, im Oldenburger Münster-land im Schnitt ca. 4,0 kg. Der entsprechende Durchschnittswert auf EU-Ebene liegt mit 5,0 kg CO2e noch deutlich höher.
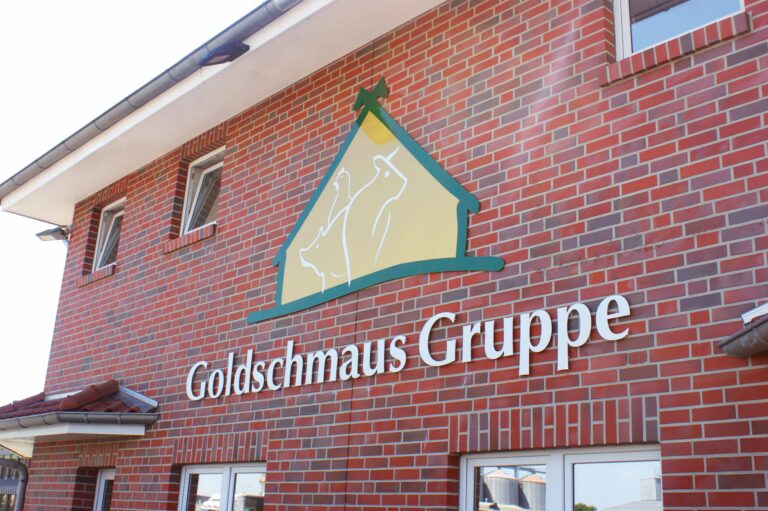
Energieverbrauch und Energiequelle zählen auch
Womit konnte der Bührener Landwirt sonst noch punkten, um den guten CO2-Wert zu erreichen? „Ein wichtiger Punkt ist die Energie, das heißt der Energieverbrauch, aber auch die Energiequelle“, erzählt er. Seine Stalldächer sind mit 45 KW-Photovoltaik bestückt, der Einsatz erneuerbarer Energien verbessert den CO2-Fußabdruck.
Von großem Vorteil für die Berechnung seiner CO2-Emissionen ist, dass Andre Stratmann mit einem Managementprogramm arbeitet, das inzwischen von einem Großteil der Mäster seiner Erzeugergemeinschaft verwendet wird: „Die Zahlen zum Futter liefert GS, ich gebe meine üblichen Betriebsdaten ein wie Anzahl ein- und ausgestallte Tiere, Verluste oder Wasser- und Energieverbrauch. Vom Schlachthof kommen dann noch die Schlachtdaten dazu.
„Damit mache ich meine üblichen Auswertungen – das geht quasi ‚just in time‘. Nach dem Schlachten der Schweine liefert der Schlachthof sofort seine Daten und ich kann den Durchgang auswerten“, sagt der Mäster. Die Daten im Managementprogramm sind Grundlage für die Berechnung des CO2-Fußabdruckes. „Der Aufwand für mich hält sich also in Grenzen“, freut sich Andre Stratmann.



















